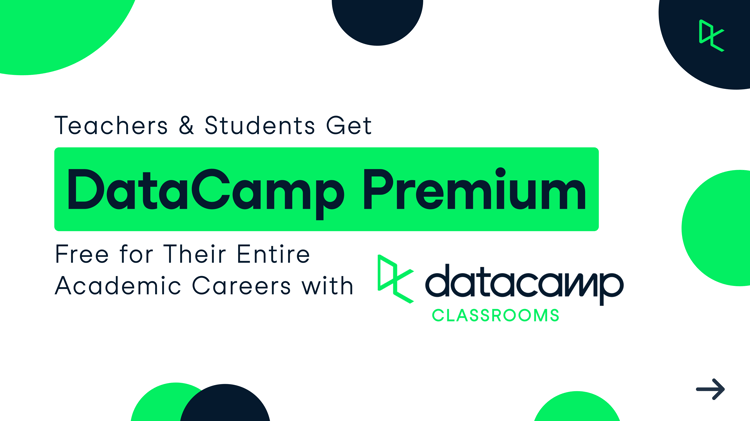Lernpfad
Die Dekomposition ist eine der interessantesten Dinge in der Datenwissenschaft. Im Kern geht es bei der Dekomposition darum, etwas Komplexes in einfachere, besser interpretierbare Teile zu zerlegen. Das kann mit einer Matrix, einem Modell oder einem Signal passieren.
Weil es eine allgemeine Idee ist, kann sie viele Formen annehmen. In der linearen Algebra gibt es die QR-Zerlegung, die Eigenwertzerlegung, die Singulärwertzerlegung und die Cholesky-Zerlegung, um nur einige zu nennen. In anderen Bereichen gibt es die Fourier-Transformation, die Hauptkomponentenanalyse und sogar die Themenmodellierung mit Methoden wie LDA. Die Variabilität in Regressionsmodellen kann in Summe der Quadrate Komponenten zerlegt werden: SST, SSR und SSE. Wir können Entscheidungsbäume sogar als eine Form der Dekomposition betrachten.
Hier werden wir einen unserer Favoriten unter die Lupe nehmen: die Zerlegung von Zeitreihen. Wenn wir dich am Ende neugierig gemacht haben, besuche unseren Kurs Forecasting in R mit Professor Rob Hyndman.
Was ist die Zeitreihenzerlegung?
Die Zeitreihenzerlegung ist eine Methode, mit der eine Zeitreihe in einzelne Komponenten, den Trend oder Trend-Zyklus, die Saisonalität und die Residuen, zerlegt wird. Der Zweck der Zeitreihenzerlegung ist es, die zugrunde liegenden Muster besser zu verstehen und die Prognosegenauigkeit zu verbessern.
Was sind die Bestandteile einer Zeitreihe?
Werfen wir einen Blick auf die Zeitreihenkomponenten. Das ist vielleicht der beste Weg, um die Idee zu verstehen.
Trend-Komponente
Der Trend einer Zeitreihe (wie der Name schon sagt) ist die langfristige Bewegung. Wir sollten erwähnen, dass die Trendkomponente oft als Trendzyklus bezeichnet wird, wobei unter Zyklen lange, unregelmäßige Muster verstanden werden. In der Vergangenheit wurden die Autoverkäufe in Sieben-Jahres-Zyklen abgewickelt (aus welchen Gründen auch immer), aber mit der Entwicklung hin zu Elektroautos ist das wahrscheinlich nicht mehr der Fall.
Die wichtigste Erkenntnis, die die Menschen aus dem Trend mitnehmen, ist in der Regel diese: Nehmen die Daten langfristig zu oder ab, oder bleiben sie stabil? Der weltweite Anstieg der Meerestemperaturen in den letzten Jahrzehnten ist ein eindeutiger (sprich: schlechter) Trend.
Saisonale Komponente
Die saisonale Komponente wird ein bisschen länger dauern, weil sie ein bisschen komplizierter ist. Die saisonale Komponente einer Zeitreihe sind die sich wiederholenden kurzfristigen Zyklen in den Daten, die in regelmäßigen Abständen auftreten. Denke täglich, monatlich, wöchentlich, vierteljährlich. Der Schlüssel dazu ist, dass die Intervalle ziemlich regelmäßig sein müssen. Du könntest zum Beispiel sehen, dass die Bestellungen in den Coffee Shops einer wöchentlichen Saisonalität folgen, wenn die Leute sonntags gerne zu Hause Kaffee kochen. (Wir werden diese Frage zu den Bestellungen im Café im nächsten Abschnitt untersuchen).
Die Sache mit der Saisonalität ist, dass sie komplizierter sein kann, als sie scheint. Denke daran, dass die Anzahl der Wochen in einem Jahr keine ganze Zahl ist (~52,18). Oder denke daran, dass die Monate nicht gleichmäßig verteilt sind: Der Februar hat 28 (oder 29) Tage, aber der Juli hat immer 31.
Und da jedes Jahr etwas mehr als 52 Wochen hat und auch die Monate variieren, kannst du die meisten Monate nicht gleichmäßig in Wochen unterteilen. Das wird deutlich, wenn du einen Kalender studierst. Aber was für einen Datenanalysten weniger offensichtlich ist, ist, dass, wenn du Daten auf wöchentlicher Ebene betrachtest und sie dann auf die monatliche Ebene aggregierst, du vielleicht uneinheitliche Dinge siehst, wie z.B. dass ein Januar vier Montage hat, der nächste aber fünf, und so können Vergleiche schwierig sein.
Die restliche / unregelmäßige / verbleibende Komponente
Alles, was übrig bleibt, nachdem wir den Trend-Zyklus und die saisonale Komponente herausgezogen haben, nennen wir passenderweise die Restkomponente, die anomale Dinge in den Daten, wie ein großes Ereignis, und zufälliges Rauschen beinhaltet. Die Restkomponente ist kein nutzloses Artefakt. Alle Daten weisen unerklärliche Schwankungen auf, und es ist wichtig, das Ausmaß dieser Schwankungen zu bestimmen. Interessanterweise nehmen residuals oft die Form einer Gauß-Verteilung In diesem Fall können wir die Ereignisse des schwarzen Schwans mit Hypothesentests bewerten.
Modelle zur Zerlegung von Zeitreihen
Nachdem wir uns nun mit den Bestandteilen einer Zeitreihe befasst haben, sollten wir erwähnen, dass es eigentlich zwei verschiedene allgemeine Arten der Zeitreihenzerlegung gibt. Wir beginnen mit dem additiven Modell.
Additive Zersetzung
Hier ist die Formel für die additive Zersetzung:
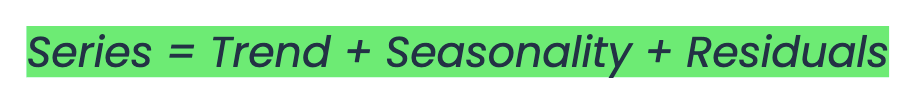
Beachte die Pluszeichen. Diese Formel besagt, dass du die ursprüngliche Zeitreihe zurückbekommst, wenn du den Trend zur saisonalen Komponente und diese zu den Residuen addierst. Im Allgemeinen verwenden wir eine additive Zerlegung, wenn die saisonalen Schwankungen im Laufe der Zeit konstant sind.
Multiplikative Zerlegung
Hier ist die Formel für die multiplikative Dekomposition. Beachte die Multiplikationszeichen in dieser Version.

Wir verwenden ein multiplikatives Modell, wenn die saisonalen Schwankungen mit dem Trend skalieren. Das heißt, wenn du siehst, dass die Größe der saisonalen Effekte größer wird, wenn sich die Gesamtreihe nach oben oder unten bewegt. Dies ist eigentlich eine Form der Heteroskedastizität.
Techniken zur Zerlegung von Zeitreihen
Bisher haben wir uns damit beschäftigt, was eine Zeitreihenzerlegung ausmacht und welche zwei Haupttypen es gibt. Im Folgenden müssen wir über die beiden gängigsten Methoden sprechen. Jedes dieser Modelle kann als additives oder multiplikatives Modell angewendet werden.
Klassische Zersetzung
Die klassische Zersetzung ist einfacher zu verstehen. Es stammt aus den 1920er Jahren, ist aber auch heute noch aktuell. Um die klassische Zerlegung zu zeigen, verwenden wir Excel. Die klassische Dekompostierung, wie die STL, die wir im Folgenden zeigen werden, kann entweder mit einem additiven oder multiplikativen Modell durchgeführt werden. Für dieses Beispiel werden wir eine additive Version erstellen.
Wenn du es selbst ausprobieren möchtest, verwende die index_1 CSV in diesem sehr interessanten Kaffeeverkaufsdatensatz, den du auf Kaggle finden kannst. Zu deiner Information haben wir die Verkäufe nach Tagen zusammengefasst.
-
Zuerst berechnen wir den Trend-Zyklus. Wir ermitteln eine wöchentliche Saisonalität, und da eine Woche sieben Tage hat, ist der saisonale Zeitraum ungerade, was bedeutet, dass unser gleitender Durchschnitt mit einem symmetrischen Fenster zentriert werden sollte. Das heißt, ein gleitender 7-Tage-Durchschnitt. Achte auf die Ausrichtung und Zentrierung von .
-
Weiterfinden wir die umgekehrte Reihe, indem wir den Trend vom Original abziehen.
-
Dann, um die saisonale Komponente zu finden, bilden wir den Durchschnitt der abgeleiteten Werte für jede saisonale Periode. Eine wichtige Ergänzung: Yie werden sehen, dass die Summe der saisonalen Komponente wahrscheinlich nicht genau Null ergibt. Achte darauf, dass du dies berücksichtigst:
-
Berechne den Mittelwert deiner saisonalen Komponente.
-
Ziehe den saisonalen Mittelwert von jedem saisonalen Wert ab.
-
-
Schließlichziehen wir für den Rest den Trend und die saisonale Periode von der ursprünglichen Reihe ab.
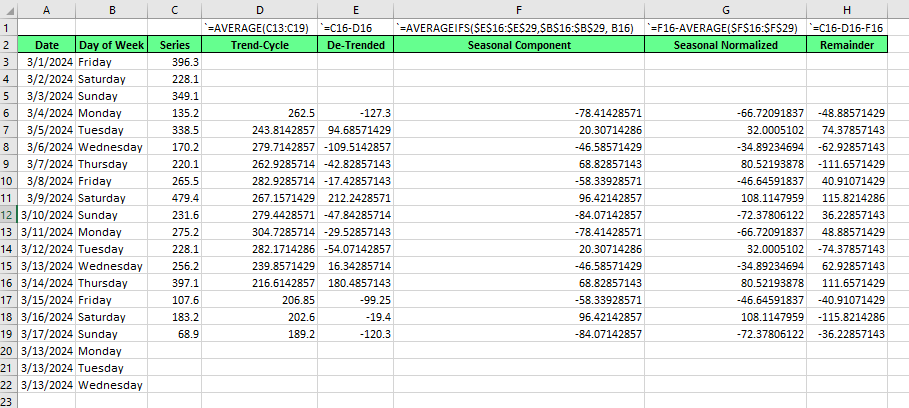
Wenn wir gesehen hätten, dass unsere Reihe einen saisonalen Effekt hat, der sich mit der Datenebene ändert, hätten wir stattdessen eine multiplikative Zerlegung in Betracht gezogen. Die Schritte für die multiplikative Zerlegung sind fast die gleichen, außer dass wir die Division statt der Subtraktion verwenden. Konkret würden wir die abweichende Reihe finden, indem wir die ursprüngliche Reihe durch den Trendzyklus dividieren. Um den Rest zu finden, würden wir später auf die ursprüngliche Reihe durch das Produkt aus Trend und saisonaler Komponente teilen. (Alternativ hätten wir auch den natürlichen Logarithmus der ursprünglichen Reihe nehmen und eine additive Zerlegung durchführen können. Das wäre funktional dasselbe.)
STL-Zerlegung
Die STL-Zerlegung, die für Seasonal and Trend Decomposition using LOESS steht, ist eine modernere Version der Zerlegung. Sie ist schwieriger zu erklären, aber sie ist im Allgemeinen flexibler als die klassische Methode. STL arbeitet mit einer Methode namens LOESS, die einfache Regressionsmodelle auf kleine, sich überschneidende Teile der Daten anpasst. Sie wendet diese lokal gewichtete Regression an, um den Trend und die saisonalen Komponenten getrennt zu isolieren.
Diese Methode behebt bestimmte Nachteile der klassischen Zerlegung, nämlich dass in der klassischen Version keine Trendzyklus- oder Restschätzungen für die erste und letzte Beobachtung verfügbar sind. Du kannst dies in den leeren Excel-Feldern in den Zeilen 3, 4, 5 und 20, 21 und 22 oben sehen.
Wir sollten auch sagen, dass der Trend-Zyklus, wie er durch die klassische Zerlegung ermittelt wird, schnelle Anstiege und Rückgänge glättet, so dass er wichtige Dinge, die in den Reihen passieren, überdecken könnte. Schließlich geht die klassische Zerlegung davon aus, dass es ein saisonales Muster gibt, aber wenn wir genügend Daten haben, können wir manchmal sehen, dass sich das saisonale Muster ändert.
Beginnen wir damit, einen Zeitplan für die Originalserie zu erstellen. Wie zuvor fassen wir in einem ersten Schritt den Kaggle-Datensatz zusammen, bevor wir die Reihen zerlegen.
coffee_sales_data <- read.csv("/Users/x/Desktop/index_1.csv")
coffee_sales_data <- as.data.frame(coffee_sales_data)library(dplyr)
library(ggplot2)
coffee_sales_data |>
group_by(date) |>
summarize(money = sum(money)) |>
ggplot(aes(x = as.Date(date), y = money)) +
geom_line(color = '#01ef63') +
labs(title = "Coffee Sales") +
labs(subtitle = "Time series")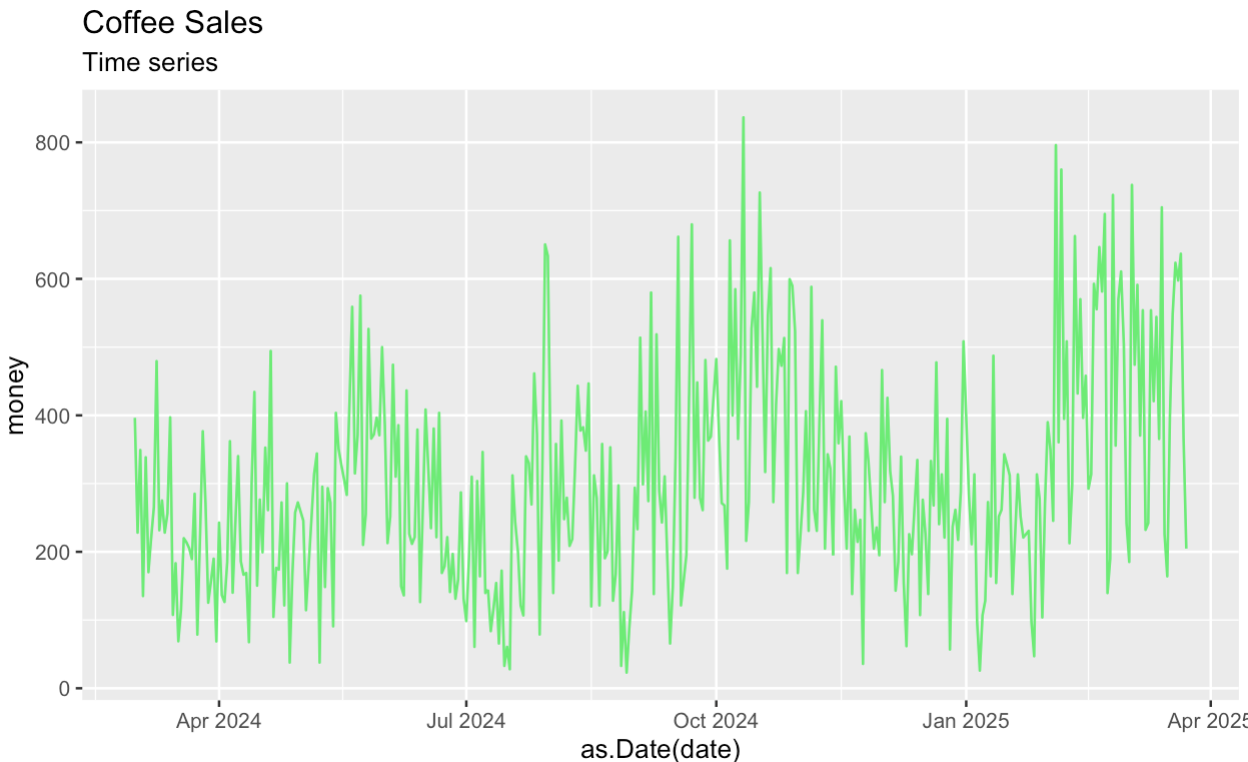
Als nächstes zerlegen wir unsere Reihen in Trend-, Saison- und Restkomponenten. Das Kästchen am oberen Rand des Zerlegungsdiagramms zeigt die ursprüngliche Reihe, wenn auch etwas gequetscht.
coffee_sales_data |>
group_by(date) |>
summarize(money = sum(money)) |>
mutate(date = as.Date(date)) |>
as_tsibble() |>
filter(date > '2024-02-28') |>
filter(date < '2024-05-01') |>
model(
STL(money ~ season(window = "periodic"))
) |>
components() |>
autoplot(color = '#203147') +
labs(title = "Coffee Sales") +
labs(subtitle = "Classical additive decomposition")
coffee_sales_data |>
group_by(date) |>
summarize(money = sum(money)) |>
mutate(date = as.Date(date)) |>
as_tsibble() |>
filter(date > '2024-02-28') |>
filter(date < '2024-05-01') |>
model(
STL(money ~ season(window = "periodic"))
) |>
components() -> ts_components
ts_components |>
autoplot(color = '#203147') +
labs(title = "Coffee Sales") +
labs(subtitle = "Classical additive decomposition")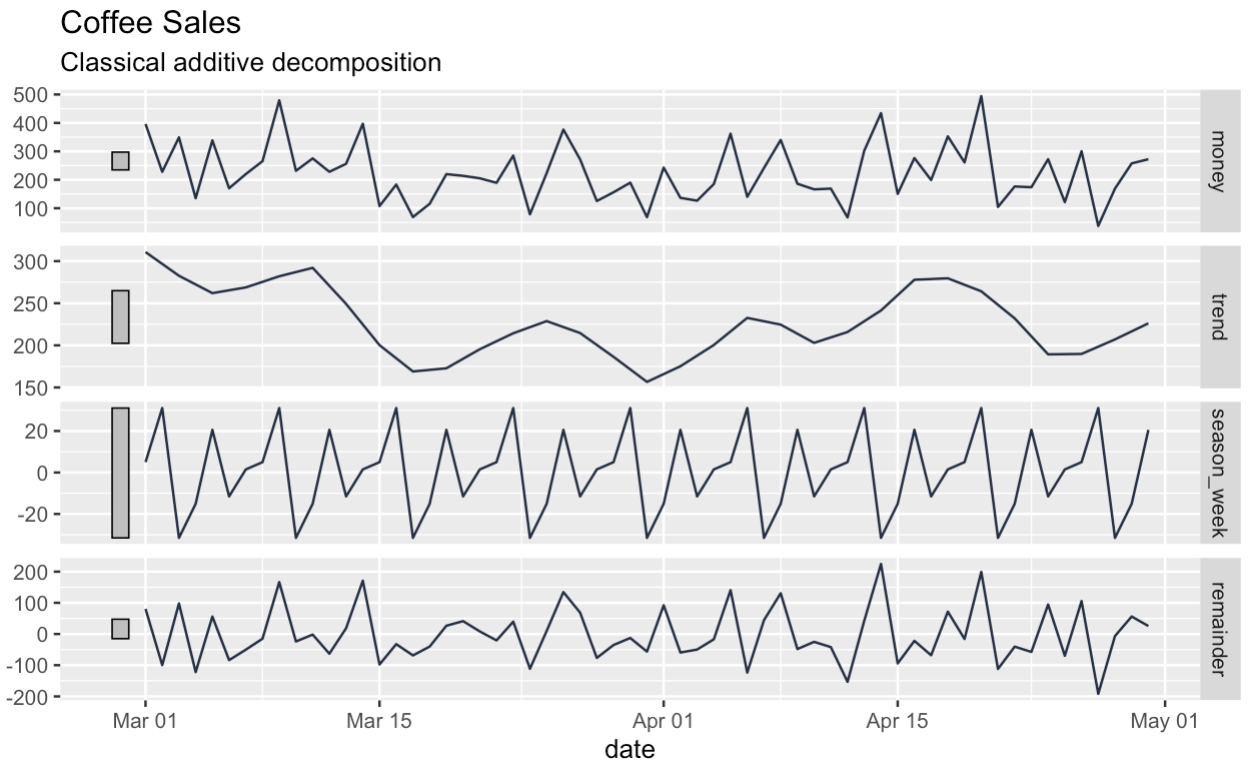
Beachte, dass der DataFrame, den wir zurückbekommen, anders als bei der klassischen Zerlegung keine Lücken am Anfang oder Ende hat.
print(ts_components)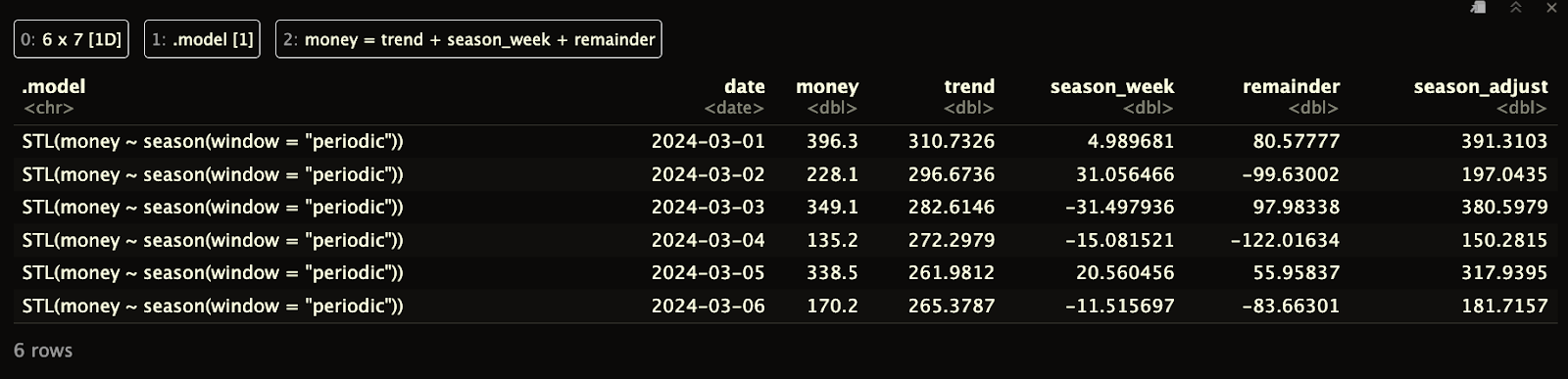
Es gibt auch einige Nachteile bei der STL-Zerlegung, und wenn du daran interessiert bist, haben wir diese Informationen in unsere FAQs aufgenommen.
Zeitreihenzerlegung und saisonale Anpassungen
Oft ist es hilfreich, eine saisonbereinigte Version der Daten zu erstellen. Dazu können wir die Trend- und die Restkomponente zusammenzählen. Oder wir könnten die saisonale Komponente von der ursprünglichen Reihe abziehen; beides würde auf dasselbe hinauslaufen.
seasonally_adjusted <- components |>
mutate(seasonally_adjusted = money - season_week)
season_adjust_data <- seasonally_adjusted |>
select(date, money, season_adjust) |>
pivot_longer(cols = c(money, season_adjust), names_to = "series", values_to = "value")
season_adjust_data |>
autoplot() + facet_wrap(~series) +
scale_color_manual(values = c(
"money" = '#203147', # blue
"season_adjust" = '#01ef63' # orange
)) +
facet_wrap(~series) +
labs(title = "Coffee Sales: Original vs Seasonally Adjusted")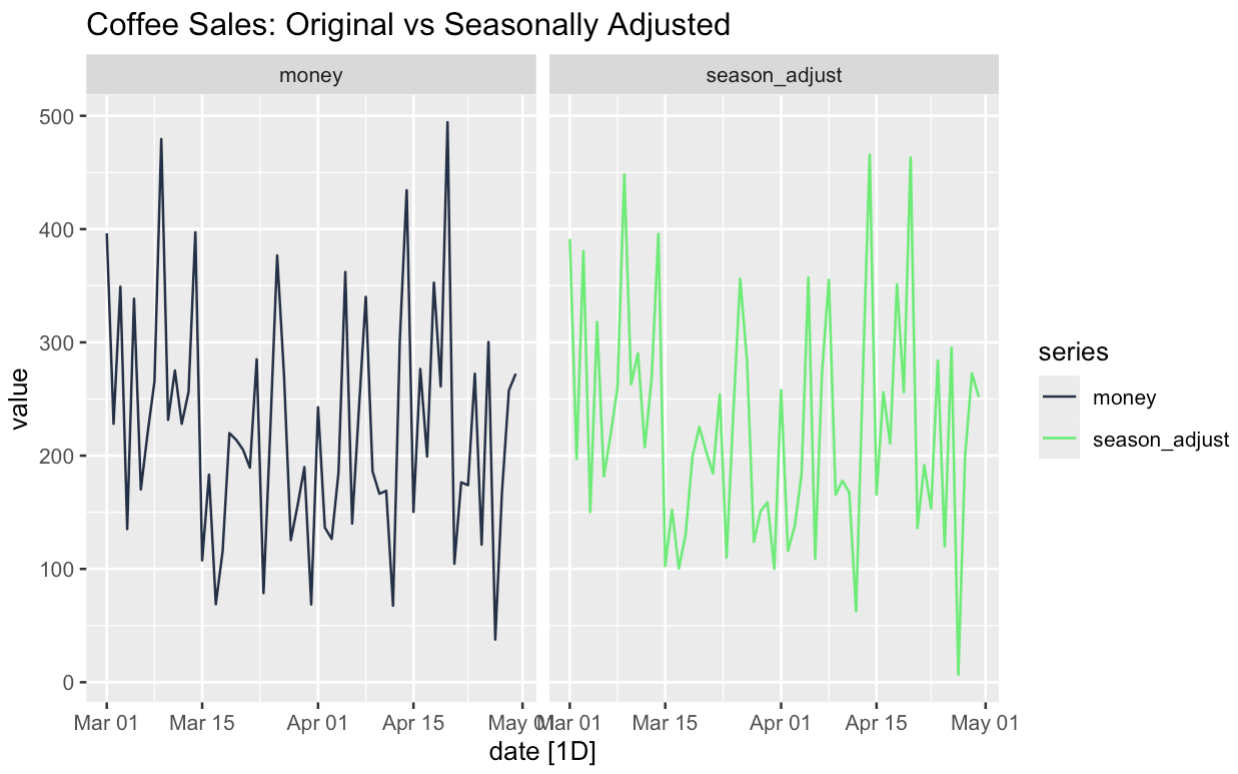
Die Stärke der saisonbereinigten Daten ist, dass sie uns helfen können, bestimmte Merkmale unserer Reihen zu verstehen. Wir können zum Beispiel sehen, ob der zugrunde liegende Trend das Ergebnis von Saisonalität ist. Zweitens können wir ungewöhnliche Vorkommnisse in den Daten genauer untersuchen. Denken wir, dass unsere Freitagsaktion funktioniert hat, weil es ein Freitag war oder weil es eine Aktion war? Nun, mit Hilfe der Zeitreihenzerlegung und der Saisonbereinigung können wir solche Fragen testen.
Zeitreihendekomposition und Vorhersage
Es wird dich vielleicht überraschen zu hören, dass die Zeitreihenzerlegung auch bei Prognosen hilfreich ist. Wir denken darüber auf zwei Arten nach. Zunächst wollen wir unsere Zeitreihenkomponenten verstehen, damit wir entscheiden können, welches Prognosemodell wir verwenden sollten. Wenn wir eine starke Saisonabhängigkeit feststellen, können wir zu Modellen wie der exponentiellen Glättung nach Holt-Winters oder der ETS-Methode greifen, die speziell dafür entwickelt wurden, sowohl Trend- als auch saisonale Komponenten zu berücksichtigen.
Zweitens können wir sogar zerlegte Daten als Teil unserer Prognosen verwenden, was uns Optionen eröffnet. Wir können zum Beispiel ein nicht saisonales Prognosemodell auf eine saisonbereinigte Version unserer Daten anwenden. (Wir können die saisonale Komponente später wieder einführen). Die Saisonbereinigung ist besonders hilfreich, wenn wir flexible Modelle wie die Standard-ARIMA und die lineare Regression verwenden wollen.
Hier erstellen wir ein einfaches ARIMA-Modell zur Prognose der saisonbereinigten Daten.
season_adjust_data_filtered <- season_adjust_data |>
filter(series == "season_adjust") |>
as_tsibble(index = date)
seasonal_adjust_arima_model <- season_adjust_data_filtered |>
model(
ARIMA(value)
)
seasonal_adjust_arima_model |>
forecast(h = "14 days") |>
autoplot(season_adjust_data_filtered, color = '#01ef63') +
labs(title = "Forecast of Seasonally Adjusted Coffee Sales",
subtitle = "Simple ARIMA Model",
y = "Money (Seasonally Adjusted)",
x = "Date")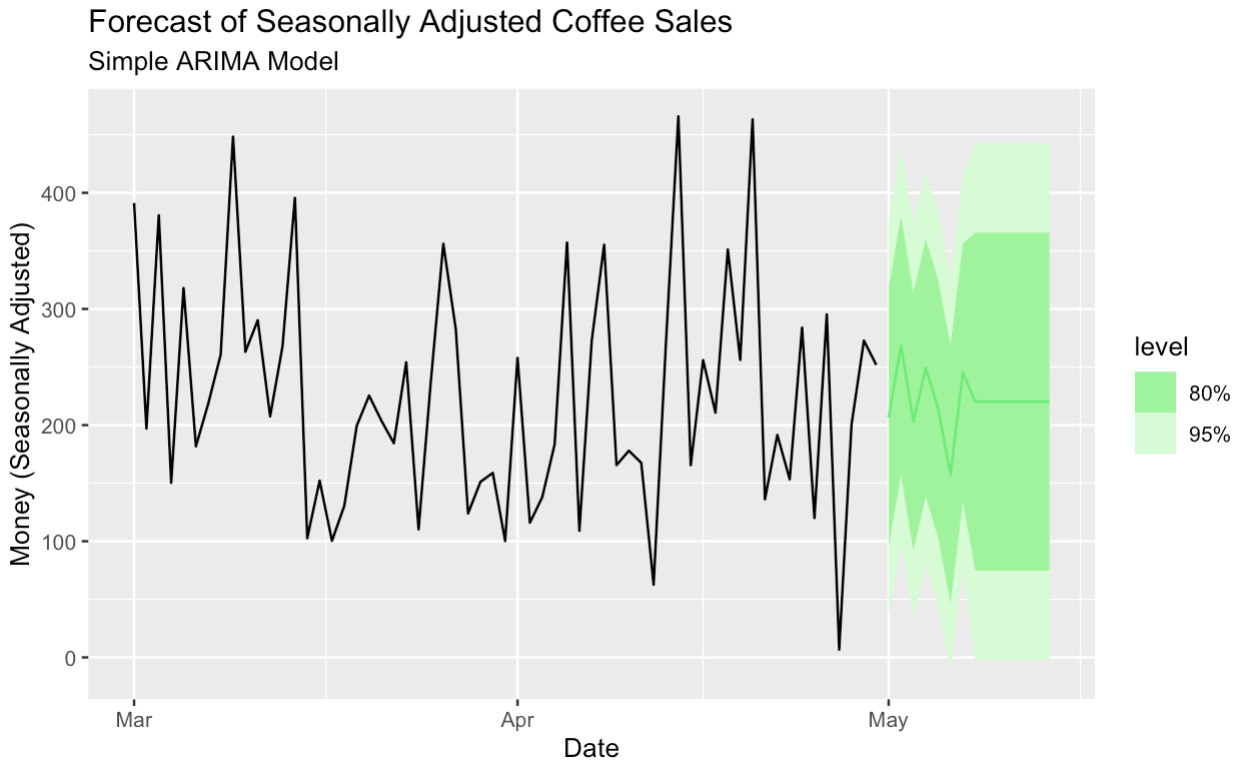
Wir können auch die saisonbereinigte Reihe prognostizieren und die saisonale Komponente wieder hinzufügen, wodurch wir effektiv eine saisonale Prognose erhalten. All dies wurde durch unsere originelle Zeitreihenzerlegung möglich.
# Build tagged historical and forecast data
historical_data <- components |>
as_tibble() |>
select(date, money) |>
mutate(source = "historical")
forecast_data <- final_forecast |>
as_tibble() |>
transmute(date, money = money_forecast) |>
mutate(source = "forecast")
# Bind and create tsibble
full_data <- bind_rows(historical_data, forecast_data) |>
as_tsibble(index = date, validate = FALSE)
# Plot with color by source
full_data |>
ggplot(aes(x = date, y = money, color = source)) +
geom_line() +
scale_color_manual(values = c(
"historical" = "#203147", # dark blue for real data
"forecast" = "#01ef63" # green for forecast
)) +
labs(
title = "Coffee Sales: Actual and Forecast",
subtitle = "Historical vs Forecast",
y = "Money",
x = "Date"
)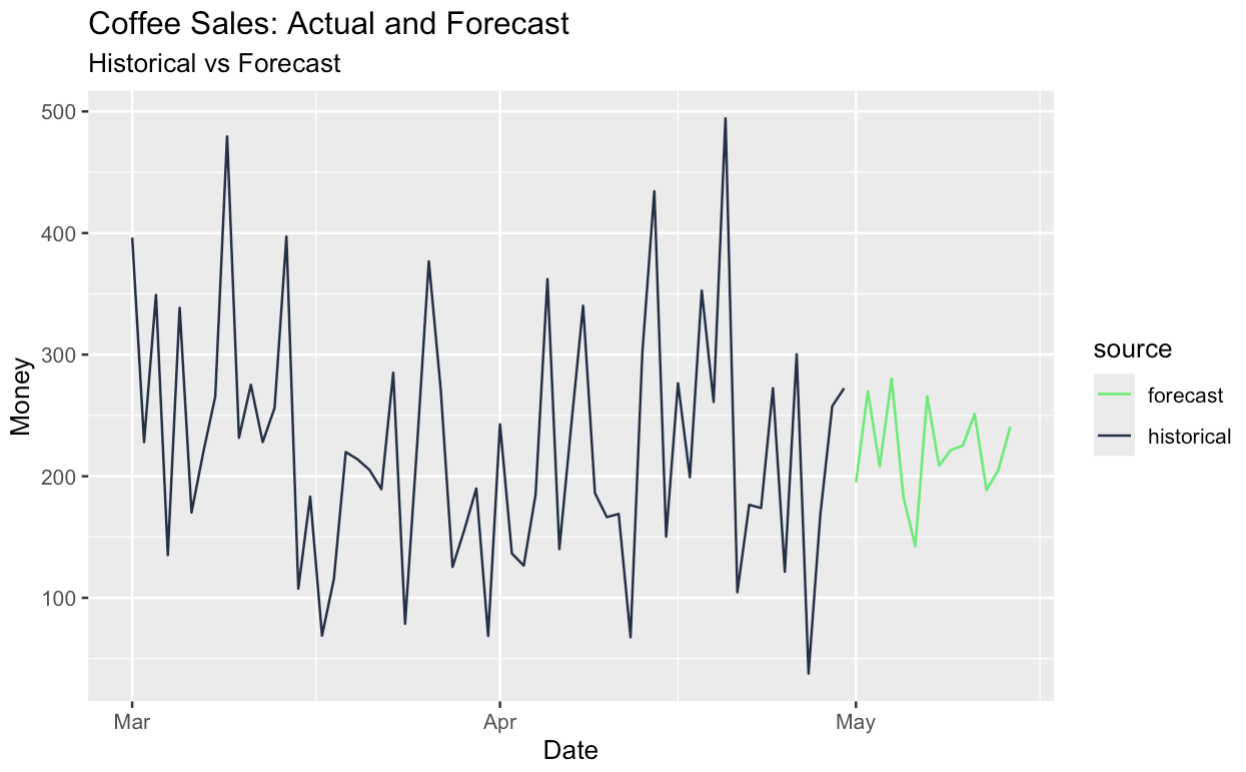
Schlussgedanken
Ich hoffe, unser Artikel über die Zerlegung von Zeitreihen hat dir gefallen! Vergiss nicht, dass die Zerlegung nur ein Teil der Zeitreihenanalyse ist. Um ein Experte zu werden, solltest du den Kurs "Forecasting in R" bei Professor Rob Hyndman belegen, der bei der Entwicklung der R-Pakete geholfen hat, die wir für unsere Visualisierungen verwendet haben. Wir haben auch einen Kurs über die Visualisierung von Zeitreihendaten in Python, falls du die Ideen in diesem Artikel interessant findest, aber Python bevorzugst, das für diese Art von Aufgaben ebenfalls sehr gut geeignet ist.
Werde Data Science zertifiziert
Bringe deine Karriere als professioneller Datenwissenschaftler voran.


Ich bin ein Inhaltsstratege, der es liebt, komplexe Themen zu vereinfachen. Ich habe Unternehmen wie Splunk, Hackernoon und Tiiny Host geholfen, ansprechende und informative Inhalte für ihr Publikum zu erstellen.
FAQs
Was ist eine Zeitreihenzerlegung?
Bei der Zeitreihenzerlegung wird eine Zeitreihe in drei interpretierbare Komponenten zerlegt: Trend, Saisonalität und Residuen (oder unregelmäßige Komponenten). Der Trend zeigt die langfristige Entwicklung an, die saisonale Komponente erfasst wiederholte kurzfristige Zyklen und der Rest spiegelt zufälliges Rauschen oder unerwartete Ereignisse wider. Die Zerlegung hilft den Analysten, die Struktur der Daten besser zu verstehen und kann die Prognosen verbessern, indem sie jede Komponente separat modelliert.
Warum gibt es fehlende Werte am Anfang und am Ende einer klassischen Zerlegung?
Zentrierte gleitende Durchschnitte erfordern symmetrische Daten um jeden Punkt. Bei einem gleitenden 7-Tage-Durchschnitt kannst du keinen zentrierten Wert für die ersten drei oder die letzten drei Tage berechnen. Daher liefert die klassische Zerlegung keine Schätzungen für die Ränder und hinterlässt Lücken bei den Trend-, Saison- und Restkomponenten an den Grenzen.
Wann sollte ich die additive und wann die multiplikative Zerlegung verwenden?
- Verwende die additive Zerlegung, wenn die saisonalen Schwankungen im Laufe der Zeit ungefähr konstant sind.
-
Verwende die multiplikative Zerlegung, wenn die saisonale Komponente mit dem Trend zu- oder abnimmt, d.h. der Effekt skaliert mit dem Niveau der Daten. Dies tritt häufig bei heteroskedastischen Zeitreihen (mit nicht konstanter Varianz) auf.
Kann ich zwischen additiver und multiplikativer Zerlegung wechseln?
Ja. Ein gängiger Ansatz ist die Log-Transformation der Reihen und die Anwendung der additiven Zerlegung. Dies ist mathematisch gesehen gleichbedeutend mit einem multiplikativen Modell in der ursprünglichen Skala. Sie kann die Modellierung vereinfachen und die Varianz stabilisieren.
Folgen die Residuen der Zerlegung immer einer Gauß-Verteilung?
Nein. Bei der STL-Zerlegung wird davon ausgegangen, dass die Residuen annähernd normalverteilt sind, aber das ist bei realen Daten nicht immer der Fall. Die Residuen können verzerrt, leptokurtisch oder durch Ausreißer und Strukturbrüche beeinflusst sein. Wenn die Zerlegung jedoch gut passt, ähnelt die Restkomponente oft dem Gaußschen Rauschen.
Was sind die Nachteile der klassischen Zersetzung?
Die klassische Zersetzung hat mehrere Einschränkungen:
-
Randeffekte: Wie bereits erwähnt, kann es weder den Trendzyklus noch die Residuen am Anfang oder Ende der Reihe schätzen.
-
Feste Saisonalität: Sie geht davon aus, dass die saisonalen Muster stabil sind und sich im Laufe der Zeit nicht ändern.
-
Empfindlichkeit gegenüber Ausreißern: Da er auf gleitenden Durchschnitten und einfachen Durchschnitten basiert, ist er anfälliger für Verzerrungen durch Extremwerte.
-
Begrenzte Flexibilität: Sie verwendet vordefinierte Glättungsregeln und kann sich nicht gut an nicht standardisierte Muster anpassen.
Was macht die STL-Zerlegung besser als die klassische Zerlegung?
STL überwindet viele der klassischen Einschränkungen der Dekomposition:
-
Behandelt nicht konstante Saisonalität, bei der sich die Muster im Laufe der Zeit ändern.
-
Liefert Schätzungen an den Grenzen, um fehlende Werte an den Rändern zu vermeiden.
-
Erlaubt benutzerdefinierte Glättungsparameter und bietet mehr Kontrolle darüber, wie stark jede Komponente geglättet wird.
-
Ist robust gegenüber Ausreißern mit robusten Anpassungsoptionen.
Hat die STL-Zerlegung irgendwelche Einschränkungen?
Ja. STL ist zwar flexibler, hat aber auch ein paar Nachteile:
-
STL unterstützt nur die additive Zerlegung, nicht die multiplikative. Wenn ein multiplikatives Verhalten vorliegt, ist eine Log-Transformation erforderlich.
-
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, müssen die Parameter für saisonale und Trendfenster angepasst werden.
-
Sie geht von einer periodischen Saisonalität aus, die unregelmäßige oder wechselnde Saisonperioden ohne Anpassungen möglicherweise nicht gut erfasst.
Was ist LOESS in der STL-Zerlegung?
LOESS (Locally Estimated Scatterplot Smoothing) ist eine Art der lokalen Regression, die bei der STL-Zerlegung verwendet wird, um glatte Kurven durch Teilmengen der Daten zu schätzen. Anstatt einen einzigen globalen Trend anzupassen, passt LOESS viele kleine, einfache Regressionen über sich überlappende Fenster an. Diese lokalisierten Anpassungen werden dann kombiniert, um glatte Schätzungen der Trend- und Saisonkomponenten zu erstellen. Das macht LOESS besonders nützlich, um allmähliche Veränderungen und unregelmäßige Muster in Zeitreihendaten zu erfassen.
Was ist ein gleitender Durchschnitt in der Zeitreihenanalyse?
Ein gleitender Durchschnitt ist eine Glättungsmethode, die verwendet wird, um kurzfristige Schwankungen zu reduzieren und längerfristige Trends in Zeitreihendaten hervorzuheben. Dabei wird der Durchschnitt der Werte über ein festes Fenster (z. B. 7 Tage oder 12 Monate) ermittelt, das sich entlang der Reihe "bewegt". Ein gleitender 7-Tage-Durchschnitt zum Beispiel glättet jeden Punkt, indem er ihn mit den drei Tagen davor und danach mittelt. Gleitende Durchschnitte werden in der Regel verwendet, um die Trendkomponente in der klassischen Zerlegung zu schätzen.
Was ist ein Dekompositionsmodell?
Ein Dekompositionsmodell ist eine Möglichkeit, eine Zeitreihe in einzelne Teile zu zerlegen, die jeweils eine andere Art von Muster in den Daten erklären. Diese Teile umfassen in der Regel einen Trend (die langfristige Richtung), Saisonalität (sich wiederholende kurzfristige Zyklen) und Residuen (zufälliges Rauschen oder unregelmäßige Ereignisse). Es gibt zwei Haupttypen von Zerlegungsmodellen: additive, bei denen die Teile durch Addition miteinander kombiniert werden, und multiplikative, bei denen die Teile durch Multiplikation miteinander kombiniert werden. Die Wahl zwischen ihnen hängt davon ab, ob die Größe der saisonalen Veränderungen konstant bleibt oder mit dem Gesamtniveau der Daten wächst.